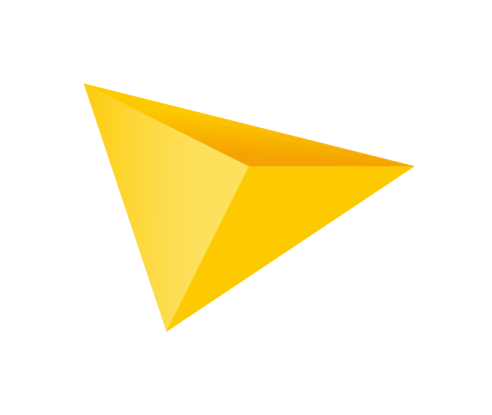Heizen mit Flusswasser
Forschungsprojekt der TU Darmstadt erfasst erstmals systematisch Aquathermie-Anlagen
18.11.2025 von Claudia Staub
Flüsse und andere Gewässer enthalten „natürliche“ Wärme – ein Potential, das für die Energiewende bislang wenig erschlossen ist. Die Wissenschaftlerin Jessika Gappisch von der TU Darmstadt will das ändern.

Fließgewässer in Deutschland erreichen im Jahresdurchschnitt Temperaturen von acht bis zehn Grad – mit steigender Tendenz. Diese Wärme lässt sich als Energiequelle nutzen, etwa für die Beheizung von Wohngebäuden. Wärme macht rund die Hälfte des Energieverbrauchs in Deutschland aus. Der Anteil erneuerbarer Energien liegt hier deutlich unter dem des Stromsektors. Über 70 Prozent der Heizsysteme werden mit fossilen Brennstoffen wie Gas und Öl betrieben. Wärmepumpen gelten als klimafreundliche Alternative – ihr Anteil beträgt aktuell aber nur rund sechs Prozent.
Das Prinzip von Wärmepumpen ist simpel: Aus der Umwelt wird Wärmeenergie entzogen und mit Hilfe eines Kältemittels und eines Kreislaufs in nutzbare Heizwärme umgewandelt. Das Kältemittel nimmt dabei die (Wärme-)Energie auf und verdampft. Dieser Dampf wird in einem Kompressor unter Zufuhr von Strom verdichtet, wobei die Temperatur des Dampfs ansteigt. Diese Wärme wird „abgegriffen“ und auf das Wasser eines Heizungsnetzes übertragen, wobei das Kältemittel wieder flüssig wird. Danach beginnt der Kreislauf von vorn.
Aquathermie: Wärme aus Flüssen nutzbar machen
„Die in Gewässern gespeicherte Wärme wird schon heute mit Hilfe von Aquathermie-Anlagen nutzbar gemacht“, sagt Jessika Gappisch vom Fachgebiet Wasserbau und Hydraulik des Fachbereichs Bau- und Umweltingenieurwissenschaften der TU Darmstadt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Wärmepumpen, die Umgebungsluft nutzen, arbeiten Aquathermie-Anlagen unter anderem mit Flusswasser. Diese Anlagen entziehen dem Wasser Wärme, erhitzen damit Heizungswasser und speisen dieses in einzelne Haushalte oder ein Versorgungsnetz ein.
Je nach Bedarf und Größe der Anlage variiert die bereitgestellte Temperatur. Großanlagen können Heizungswasser auf bis zu 100 Grad erhitzen und in ein Fernwärmenetz einspeisen. In kleineren Vierteln kommen sogenannte kalte Nahwärmenetze zum Einsatz, bei denen die Wassertemperatur bei rund 20 Grad liegt. Die Flusswärme wird dann über ein kleines Wärmenetz in die Nachbarschaft verteilt und erst in den einzelnen Häusern durch Wärmepumpen auf die gewünschte Temperatur erhitzt. Auch die Wärmeversorgung von Einzelstandorten wie zum Beispiel Mühlengebäuden kann sinnvoll sein.
Für den Betrieb von Aquathermie-Anlagen ist die Zufuhr von Strom erforderlich. Obwohl dieser in Deutschland nicht billig ist, kann sich der Einsatz von Aquathermie-Anlagen dennoch lohnen. Für Wärmepumpen gilt, dass aus einer Kilowattstunde Strom das Drei- bis Fünfache an Wärmeenergie erzeugt werden kann. Eine Wärmepumpe ist dabei umso effizienter, je höher die Temperatur der Wärmequelle ist. Da die Wassertemperaturen in der kalten Jahreszeit höher sind als die der Luft, rentieren sich Flusswasserpumpen gerade dann mehr, wenn am meisten geheizt werden muss.
Genehmigungen und Gesetze: Was Flusswärme noch bremst
Die größte Schwierigkeit bei der Nutzung von Flusswärme sei gar nicht so sehr die technische Umsetzung oder die Wirtschaftlichkeit, sagt Gappisch, sondern liege bei der Planung und Genehmigung. „Die fehlenden Erfahrungswerte führen zu Unsicherheiten“, sagt sie.
Das Forschungsprojekt „Aquathermie-Viewer Deutschland“, an dem Gappisch beteiligt ist, und das noch bis Anfang 2027 läuft, will diese Lücke schließen. Das von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt geförderte Projekt erfasst bestehende Anlagen, stellt sie kartografisch dar und macht die Daten öffentlich zugänglich. Wie viele Aquathermie-Anlagen es derzeit in Deutschland gibt, ist bisher unklar. „Im Rahmen unseres Forschungsprojekts haben sich derzeit 75 Prozent der deutschen Genehmigungsbehörden zurückgemeldet und dabei etwa 100 Anlagen gemeldet“, berichtet Gappisch.
Die derzeit größte Flusswärmepumpe Deutschlands befindet sich in Mannheim. Sie liefert 20 Megawatt thermische Energie und soll perspektivisch auf 150 Megawatt aufgestockt werden – damit ließen sich mehrere Tausend Haushalte versorgen. Ähnliche Projekte mit vergleichbarer Leistung entstehen in Köln (150 Megawatt im Niehler Hafen) und Hamburg (230 Megawatt im Energiepark Tiefstack). Weitere Details zu den bestehenden Anlagen werden im Lauf des Forschungsprojekts noch erwartet.
Eine weitere Herausforderung sieht Gappisch im ökologischen Gesetzesrahmen. Aquathermie-Anlagen entnehmen dem Fluss Wasser, entziehen ihm Wärme und führen es leicht abgekühlt wieder zurück. Oder sie entnehmen aus dem Gewässer die Wärme durch Wärmeübertrager, die direkt im Gewässer eingebaut sind. „Während es gesetzliche Vorgaben zur Einleitung von erwärmtem Wasser gibt, zum Beispiel Kühlwasser aus Kraftwerken, fehlen für die Abkühlung des Wassers klare Regelungen“, sagt sie. Fachliche Fragen seien bisher ungeklärt: Welche Grenzwerte sind sinnvoll? Wie wirkt sich eine Temperaturfahne aus? Und wie lässt sich der Austritt von Kältemittel sicher ausschließen? Hier sieht die Wissenschaftlerin weiteren Forschungsbedarf. Temperaturveränderungen im Gewässer sollten moderat bleiben und sich an natürlichen Schwankungen orientieren. Richtig umgesetzt kann Aquathermie sogar zur ökologischen Entlastung beitragen – indem sie gezielt überschüssige Wärme aus überhitzten Gewässern infolge des Klimawandels abführt.
„Mit unserem Projekt wollen wir Aufklärungsarbeit leisten“, betont Gappisch. Die entstehende Datenbank soll Behörden, Planungsbüros und Energieversorgern als Wissensbasis dienen und Grundlagen für künftige Genehmigungsprozesse schaffen – und damit zur weiteren Verbreitung von Flusswärme beitragen.