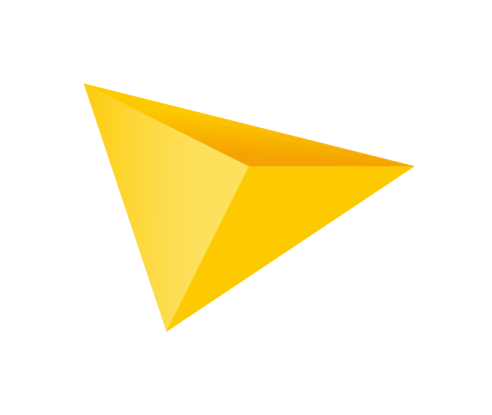Spurenstoffe im Wasserkreislauf
Herausforderungen, Lösungen und Verantwortlichkeiten
20.03.2025 von Stefanie Warmuth
Am Abend des 13. März fand im Georg-Christoph-Lichtenberg-Haus zum mittlerweile 8. Mal der E+E Diskurs statt. Das Thema „Spurenstoffe im Wasserkreislauf“ sorgte in der Tat für einigen Diskussionsbedarf.

Zu Gast waren Vertreter:innen aus Forschung, Wissenschaft und Behörden und diskutierten gemeinsam mit unserem Moderator sowie dem Publikum darüber, welche Wege Mikroverunreinigungen wie Arzneimittelrückstände, Pestizide oder Industriechemikalien in unsere Gewässer finden, welche technischen Lösungen es zur Reduzierung gibt und wer letztendlich für die Kosten aufkommen soll.
Die Veranstaltung wurde eröffnet und moderiert von Prof. Dr.-Ing. Peter Pelz, Vizepräsident der TU Darmstadt und Co-Sprecher am Forschungsfeld Energy and Environment. In ihrem Grußwort betonte die TU-Präsidentin, Prof. Dr. Tanja Brühl die Bedeutung des Themas für Gesellschaft und Umwelt, und unterstrich dabei die Verantwortung der Wissenschaft, praxistaugliche Lösungen zu erforschen. Sie wies darauf hin, dass sauberes Wasser nicht nur eine ökologische, sondern auch eine soziale Frage ist, die langfristig sichergestellt werden muss.
Erster Impulsvortrag: Woher kommen Spurenstoffe eigentlich?
Den fachlichen Auftakt bildete ein Impulsvortrag über die Emissionsquellen von Mikroverunreinigungen. Professor Dr. Ternes von der Bundesanstalt für Gewässerkunde zeigte anhand verschiedener Untersuchungen, dass Spurenstoffe nicht nur aus Haushalten stammen, sondern vor allem Industrieabwässer eine bedeutende Quelle sind. Viele Substanzen gelangen zudem über Regenwasserkanäle und Mischwasserentlastungen in die Umwelt – insbesondere bei Starkregen, wenn Kläranlagen überlastet sind. Auch exfiltrierendes Grundwasser kann eine entscheidende Rolle spielen.
Zweiter Impulsvortrag: Die 4. Reinigungsstufe als Lösung?
Im zweiten Vortrag widmete sich Professorin Susanne Lackner, Expertin für Wasser und Umweltbiotechnologie an der TU Darmstadt, den Möglichkeiten und Grenzen der 4. Reinigungsstufe auf Kläranlagen. Während herkömmliche Kläranlagen bereits viele Verunreinigungen entfernen, sind sie für bestimmte Stoffe nicht ausgelegt. Technologien wie Aktivkohlefiltration, Ozonung oder Advanced Oxidation Processes können zusätzliche Schadstoffe herausfiltern, sind aber mit hohen Kosten und Energieaufwand verbunden. Dabei wurde auch darauf hingewiesen, dass Abwassermonitoring und moderne Analytik entscheidend sind, um überhaupt zu erkennen, welche Substanzen entfernt werden müssen.
Die Podiumsdiskussion: Herausforderungen und Verantwortlichkeiten
Im Anschluss folgte die Podiumsdiskussion, in der sich die Experten zu analytischen Messverfahren, Abwassermonitoring und den Herausforderungen der Finanzierung austauschten. Ein zentrales Thema der Diskussion war die erweiterte Herstellerverantwortung: Sollten nicht diejenigen, die Spurenstoffe in Umlauf bringen – etwa Pharma- oder Chemieunternehmen – auch für deren Beseitigung aufkommen?
Während einige betonten, dass eine solche Regelung das Verursacherprinzip stärke und Innovationen anregen könnte, wiesen andere auf die praktische Umsetzbarkeit und rechtliche Hürden hin. Auch die Rolle der Verbraucher wurde diskutiert: Bewusstere Nutzung von Medikamenten und verantwortungsvoller Umgang mit Chemikalien könnten bereits einen wichtigen Beitrag leisten.
Besonders engagiert zeigte sich das Publikum, das gezielt nach der Finanzierung fragte: Wer trägt die Kosten für neue Reinigungsstufen? Werden sie über Abwassergebühren auf die Verbraucher umgelegt? Oder gibt es Fördermöglichkeiten durch den Staat oder die Industrie? Die Experten waren sich einig, dass es keine einfache Lösung gibt – es braucht ein Zusammenspiel aus staatlicher Unterstützung, Herstellerverantwortung und effizienten Technologien.
Fazit: Ein komplexes Problem mit vielen Stellschrauben
Die Diskussion machte deutlich, dass Spurenstoffe im Wasserkreislauf eine vielschichtige Herausforderung darstellen. Technische Lösungen existieren, doch die Umsetzung erfordert finanzielle, politische und gesellschaftliche Anstrengungen. Die Diskussion hat gezeigt, dass bereits viel Wissen vorhanden ist – nun müssen konkrete Schritte folgen. Einig waren sich die Teilnehmer darüber, dass bessere Überwachungssysteme, gezielte Maßnahmen zur Reduzierung von Emissionen und eine klare Verantwortungszuweisung der Schlüssel für eine nachhaltige Wasserqualität sind. Am Ende bleibt die Erkenntnis:
Nur durch Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft kann es gelingen, unsere Wasserressourcen langfristig zu schützen.
Der E+E Diskurs im Lichtenberg-Haus
Der E+E Diskurs dient dem offenen, kritischen und fundierten Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis. Es werden Lessons-Learned geteilt, Methoden und Technologien kritisch diskutiert und der Mensch in den Mittelpunkt der Diskussion gestellt.