Neue Studie: Unterseekabel systematisch schützen
UNIDIR-Report mit Beteiligung eines TU-Wissenschaftlers stellt Resilienzmodell vor
30.07.2025
Internet-Unterseekabel werden international zunehmend als kritische Infrastruktur eingeordnet. Bisher fehlte jedoch eine systematische Untersuchung zur Wirksamkeit der unterschiedlichen Schutzmaßnahmen. Jonas Franken, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am TU-Fachgebiet PEASEC sowie Forscher am Cybersicherheitszentrum ATHENE, war an einer Studie des UNIDIR (United Nations Institute for Disarmament Research) beteiligt, die diese Lücke schließen soll.
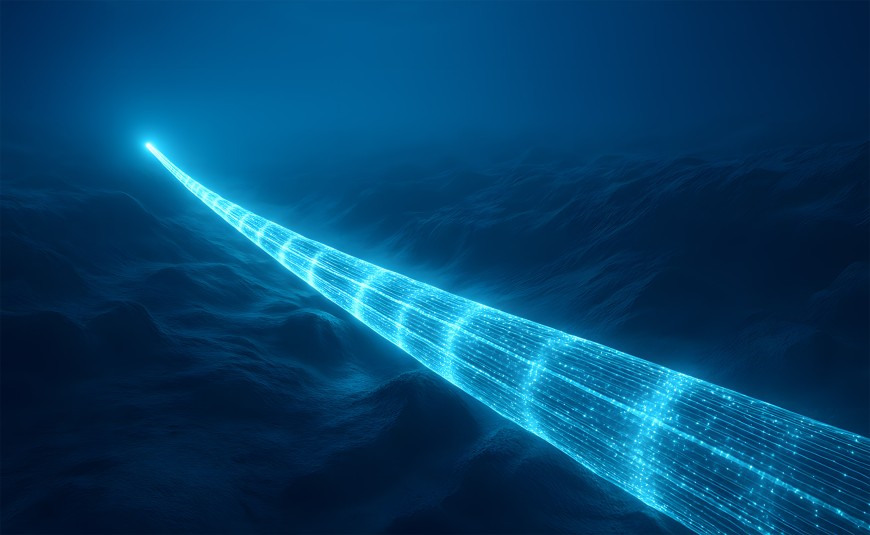
Die Studie ordnet staatliche Schutzmaßnahmen für Unterseekabel einem Resilienzmodell zu, an dem Staaten und Betreiber ableiten können, wie gut sie auf Störungen ihrer Unterseekabel vorbereitet sind. Das Modell hilft, Schwachstellen systematisch zu erkennen und gezielt weitere Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
Unterseekabel übermitteln fast 99 Prozent des weltweiten Datenverkehrs zwischen Kontinenten, schnelle und zuverlässige Internetverbindungen hängen von ihnen ab. Die Kabel werden oft beschädigt, versehentlich durch Fischernetze, Schiffsanker, häufig aber auch durch gezielte Sabotageakte, wie bei Fällen in der Ostsee vermutet, die sich vor kurzem ereignet haben. Um diese Kabel besser schützen zu können, stufen immer mehr Staaten diese Kabel als kritische Infrastruktur (KRITIS) ein. Die Studie des UNIDIR „Achieving Depth – Subsea Telecommunications Cables as Critical Infrastructure“ zeigt, wie Staaten Seekabel als KRITIS einstufen können und was diese Einstufung in der Praxis bedeutet. Sie wurde unter anderem von Doktorand Jonas Franken verfasst. Er forscht am Fachgebiet Wissenschaft und Technik für Frieden und Sicherheit (PEASEC) der TU Darmstadt und am Nationalen Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit ATHENE.
Drei Kategorien für den Seekabel-Schutz
Für die Studie wurden weltweit spezifische Schutzmaßnahmen der unterschiedlicher Länder gesammelt und hieraus ein Resilienzmodell entwickelt, das Schutzmaßnahmen in drei Kategorien einteilt. Die erste ist die absorptive Kapazität, also wie gut das Schutzsystem Schäden vorbeugt. Australien beispielsweise hat ein präventives Genehmigungssystem für das Verlegen von Unterseekabeln. Kabel dürfen nur in bestimmten geschützten Zonen anlanden, was Risiken durch Fischerei oder Schifffahrt stark reduziert. Frankreich hat eine zentrale Cybersicherheitsstelle, die kritische Infrastrukturen überwacht, wozu auch das Monitoring von Seekabeln und die Koordinierung mit dem Militär gehört.
Die zweite Kategorie ist die wiederherstellende Kapazität, das heißt wie schnell und effektiv ein zerstörtes Seekabel repariert werden kann. In Japan wurden nach dem schweren Seebeben, das 2011 zu einem Tsunami in Fukushima führte, auch mehrere Seekabel zerstört. Mittels regionaler Koordination der Kabelschiffe und Abkommen mit internationalen Firmen war eine schnelle Reparatur dieser Schäden möglich. Ein anderes Beispiel ist Singapur, hier sind viele redundante Kabel verlegt. Fällt eines aus, wird der Datenverkehr automatisch über andere Kabel umgeleitet.
Die dritte Kategorie umfasst adaptive Kapazitäten, also wie schnell man aus den Vorfällen lernt und neue Regeln oder Technologien zum besseren Schutz einführt. Beispielhaft ist in der Studie die EU angeführt, die nach mehreren Störfällen, unter anderem in der Ostsee, ihre Strategien angepasst und die NIS2-Richtlinie, ein Cyberresilienzgesetz und gemeinsame Risikoanalysen eingeführt hat. Außerdem entstehen neue Plattformen zur Koordination zwischen Ländern und Betreibern von Seekabel-Infrastruktur. Das Vereinigte Königreich beispielsweise entwickelt seit dem Brexit eigene Kabelschutzrichtlinien und fördert neue Technologien wie Tiefsee-Sensoren, um Angriffe oder Störfälle so früh wie möglich zu erkennen.
Seekabel systematisch stärken
Ziel dieser systematisierten Erfassung ist es, Seekabel-Infrastrukturen international sicherer und robuster gegen Ausfälle zu machen. Das Modell hilft Staaten und Betreibern, Schwachstellen zu erkennen und Maßnahmen zu ergänzen. Damit stellt die Studie einen wichtigen Schritt zu einer umfassenden „Cable Security Toolbox“ dar, wie sie u.a. von der Europäischen Union gefordert wird. Darüber hinaus enthält die Studie allgemeine Empfehlungen, wie Seekabel sicherer gemacht werden können.
ATHENE/sip
