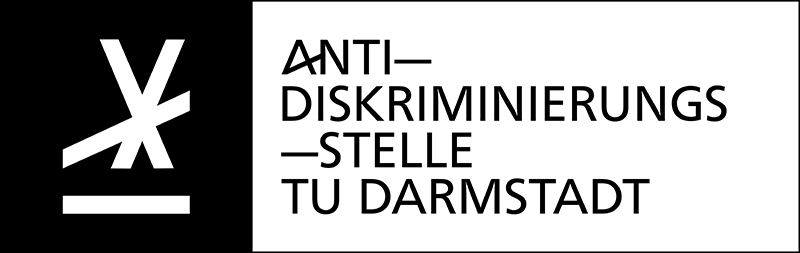Öffentlichkeitskampagne für Zusammenhalt
18.02.2025

Mit dieser Kampagne möchte die AD-S gemeinsam mit kooperierenden Abteilungen und Einrichtungen dazu einladen, Verbundenheit in die Universität kommunizieren und Haltung zu zeigen:
Gegen Polarisierung und Diskriminierung – für Pluralität und Solidarität auf dem Campus der TU Darmstadt und überall.
Ihren Ausgangspunkt nimmt die Kampagne in Vandalismus mit diskriminierendem Inhalt, der in den letzten Monaten verstärkt aufgetreten ist. Zudem lässt sich außen- wie innenpolitisch eine zunehmende Polarisierung beobachten, die uns auch im Unialltag begegnet und beschäftigt.
Unsere Universität steht aber für ein Lern- und Arbeitsumfeld in dem Vielfalt geschätzt wird – unabhängig von Geschlecht, ethnischer oder nationaler Herkunft, Religionszugehörigkeit, Behinderung oder gesundheitlicher Beeinträchtigung, Alter, sexueller Identität, sozialer Herkunft oder familiärer Betreuungs- oder Pflegeaufgaben sollen Teilhabe und Entfaltung für alle bestmöglich gegeben sein. Mit der Diversitätsstrategie und den Richtlinien gegen Diskriminierung haben wir bereits starke Instrumente.
Die universitäre Gemeinschaft lebt aber weniger durch die Papiere und Strategien die sie sich gibt, als vor allem durch die Menschen, die sich in ihren Räumen und Strukturen bewegen, und von deren Kommunikation und Umgang miteinander.
Wir freuen uns also sehr, wenn Sie sich uns anschließen, die Poster aufhängen und vor allem über deren Inhalte miteinander ins Gespräch kommen.
Zu den Begriffen der Kampagne finden Sie hier kurze Erklärtexte sowie Links zu Anlaufstellen und Materialien:
#gemeinsamTuDa
Vielen Dank an unsere Kooperationspartner*innen vom SCC, Gleichstellungsbüro, Ingenium, der HDA, dem DEO, der ZSB, den ISS in Dezernat VIII und den vielen anderen Kolleg*innen, die aus praktikablen Gründen nicht mit Logo aufgeführt sind, aber die Kampagne unterstützt haben (Projekt Better Together! (FB03), der Personalrat, die Servicestelle Familie, das Sprachenzentrum und einige andere...)